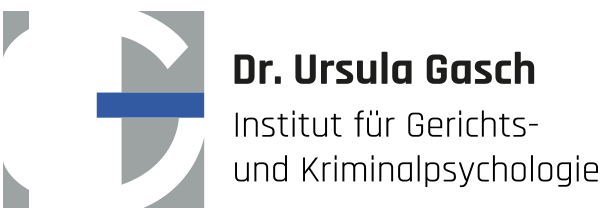Traumaspezifische Diagnostik von Extremsituationen im Polizeidienst. Polizisten als Opfer von Belastungsstörungen
Gasch, Ursula Christa. Berlin: dissertation.de Verlag im Internet
„Polizeibeamten wurde zu jeder Zeit extern und intern viel zugemutet. Ist eigentlich klar, wie viel Sprengstoff sich hier angesammelt hat?“ (Zitat eines Untersuchungsteilnehmers)
“Polizeiarbeit ist der emotional gefährlichste Beruf der Welt.“
Diese Behauptung stellte Fennell schon 1981 auf. Und obgleich es andere traumasensitive Berufsgruppen wie beispielsweise Gefängnispersonal, Soldaten und Angestellte im öffentlichen Verkehrswesen gibt, scheint die Konfrontation mit potentiell traumatisierenden Erlebnissen vornehmlich Polizisten zu treffen. So stellte beispielsweise Miller in einer Studie von 1996 als Grund für Frühberentungen von Polizeibeamten primär psychische Faktoren fest. Darunter berichteten 43% der Untersuchungsteilnehmer von traumatisierenden Erlebnissen, die sie letztendlich zum Quittieren des Dienstes veranlassten. Internationale Studien berichten von Schätzungen, denen zufolge 12%-35% aller Polizisten nach einem entsprechenden Erlebnis eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) entwickeln und dass PTBS das 5-häufigste Problem ist, weshalb Polizisten beim Polizeipsychologen vorstellig werden.
Leider existieren Daten zu diesem Phänomen nur retrospektiv und lassen keinen Aufschluss darüber zu, wie viele Polizisten, die derzeit noch ihren Dienst verrichten, an PTBS leiden. Dazu kommt, dass viele Personen mit PTBS keine Hilfe suchen bzw. Behandlung aufsuchen. Verschärfend legen Befunde den Zusammenhang von klassisch männlichen Rollenbildern und der Verleugnung von Hilfsbedürftigkeit nach berufsbedingten Traumata nahe. Es ist zu vermuten, dass die Rate der PTBS- Opfer unter Polizisten wesentlich höher als bisher vermutet liegt.
Studien, die sich mit den Folgen traumatisierender Erlebnisse und deren Diagnostik bei Polizeibeamten auf breiter und systematischer Ebene auseinandersetzen, sind im deutschen Sprachraum noch nicht zu finden. Die im Rahmen meiner Diplomarbeit (1997) durchgeführte Untersuchung im Raum Tübingen und Stuttgart war eine Pilotstudie, die sich erstmals mit dieser Thematik wissenschaftlich auseinandersetzte. Die vorliegende Untersuchung, an der sich 528 Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei des gesamten Landes Baden-Württemberg beteiligten, baut auf den Erkenntnissen der Pilotstudie und den vielfältigen Erfahrungen seit Beginn meiner psychologischen Beratertätigkeit bei der Landespolizeidirektion Tübingen im November 1996 auf. Dabei verdanke ich insbesondere der Offenheit und dem Vertrauen der Verhandlungsgruppe des Regierungsbezirks Tübingen, zu deren Mitglied ich mich zählen darf, sehr viel.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht der Einsatz der optimierten Version des in der Pilotstudie eingesetzten diagnostischen Instruments zur Erfassung der Auswirkung traumatisierender Ereignisse im Polizeidienst. Daneben beschäftigt sich die Untersuchung mit der Gewinnung weiterer Erkenntnisse über mögliche Zusammenhänge intrapsychischer und personaler Ressourcen und der Entstehung bzw. Aufrechterhaltung einer PTBS. Von besonderem Interesse war auch, ob und inwieweit die Art eines diensttypischen Ereignisses sich auswirkte. Dabei fand zunächst eine grundlegende Auseinandersetzung mit diensttypischen Situationen und deren Belastungsgehalt für Polizisten statt. Es ist fraglich, ob es immer nur die spektakulären und medienwirksamen Ereignisse, wie beispielsweise der Schusswaffengebrauch und andere durch aktives Involviertsein eines Polizisten charakterisierten Situationen sind, die zu einer PTBS führen. Hat die häufige Konfrontation mit schwerwiegenden Konsequenzen vorangegangener Ereignisse, wie z.B. der Umgang mit Opfern schwerer Straftaten oder Leichensachen, vielleicht gleichwertige gesundheitliche und psychosoziale Folgen?
Eine fundierte Diagnostik im klinischen Sinne erhöht im Allgemeinen die Chance effektiver Intervention. Um Aufschluss über gezielte Interventionsmöglichkeiten zu erhalten, darf aber gerade bei der auf spezielle Berufsgruppen bezogenen Psychotraumatologie nicht die Auseinandersetzung mit der Kultur der betreffenden Berufsgruppe fehlen. Auch diesem Anliegen versucht die Autorin gebührend Rechnung zu tragen.